
Wie die Schweiz den Selbstversorgungsgrad erhöhen könnte
«Der Selbstversorgungsgrad wird definiert als Verhältnis der Inlandproduktion zum inländischen Gesamtverbrauch», schreibt agrarbericht.ch. Der inländische Gesamtverbrauch setzt sich aus inländischer Produktion plus Importe, aber minus Exporte und Vorräte zusammen. Man unterscheidet zwischen Selbstversorgungsgrad brutto und netto. Bei Netto wird miteingerechnet, dass ein Teil der Inlandproduktion nur möglich ist durch importierte Futtermittel.
Der Brutto-Selbstversorgungsgrad der Schweiz lag 2022 bei 53% (Quelle: agrarbericht.ch). Zum Vergleich; in Deutschland liegt er bei rund 88%, in Frankreich bei 100%, in Spanien bei 109%... Die Schweiz liegt also mit ihren 53% ziemlich abgeschlagen im hinteren Bereich. Warum ist das so? Und wie liesse sich das ändern? Das habe ich Sven Studer, unseren Experten für regenerative Landwirtschaft gefragt. Er hat zwei Lösungsvorschläge:
1. Weniger Biodiversitätsförderflächen
Svens erster Vorschlag zur Erhöhung des Selbstversorgungsgrads klingt kontraintuitiv, besonders weil er aus dem Mund desjenigen Mannes kommt, der sich bei uns für regenerative Landwirtschaft einsetzt. «Man müsste die Biodiversitätsförderflächen abschaffen», sagt Sven Studer. 19% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Schweiz sind nämlich reine BFF also Biodiversitätsförderflächen. BFF können z.B. Nützlingsstreifen, Trockenmauern oder Hochstammbäume sein und werden mit Direktzahlungen belohnt (Quelle: sbv.ch).
Klingt doch super – oder etwa nicht? Laut Sven Studer ist das der falsche Ansatz. Viel besser wäre, wenn auf der ganzen landwirtschaftlichen Nutzfläche Massnahmen für die Förderung der Biodiversität umgesetzt würden! Dann könnten diese 19% auch für Lebensmittelanbau genutzt werden plus würde mehr Fläche insgesamt biodivers werden. Win-Win also.
Das ist auch ein Ansatz der regenerativen Landwirtschaft. Statt spezifischer Biodiversitätsflächen macht man Unter- und Zwischensaaten sowie Gründünungen, setzt auf Humusauf- statt -Abbau, schützt durch weniger Bodenbearbeitung die Biodiversität im und nicht nur über dem Boden…
Doch solche Massnahmen werden nicht unterstützt durch Direktzahlungen. Ein Bauer, der 1 Quadratmeter BFF macht, kriegt Geld. Der Bauer, der in seiner gesamten Kultur die Biodiversität fördert, schaut meist ein. Schon 2024 hat sich Martin Jucker klar gegen die damaligen Initiative zur Förderung der Biodiversität ausgesprochen.

2. Bei der Fleisch- und Milchwirtschaft ansetzen
Sven Studers zweiter Vorschlag bezieht sich auf die Fleisch- und Milchwirtschaft. Komplett darauf zu verzichten sei Blödsinn – denn die Schweiz hat viel Fläche, die nicht mit Gemüse, Getreide o.Ä. bepflanzt werden kann (z.B. in den Bergen). Das sind ideale Weiden etwa für Kühe. Tiere sind gute Verwerter von Gras – ganz im Gegensatz zu uns Menschen. Auch helfen die Tiere der Wiese – indem sie umgraben, abgrasen und mit ihrem Kot düngen. Hierzu empfehlen wir gerne den Artikel von Jürg Vollmer, in dem er erklärt, warum Kühe keine Klimakiller sein müssen.
Aber; die Nachfrage nach Fleisch und Milch ist so hoch, dass es eben nicht reicht, nur in diesen Gebieten Tiere zu halten. So werden auch auf eigentlich anderweitig nutzbaren Flächen Schweine, Kühe, Hühner etc. Gehalten – und oftmals mit importiertem Futter gefüttert. Das führt nebenbei auch zu einem Düngerüberschuss. Die Menge an Stickstoff in der Landwirtschaft konnte zwar in den letzten Jahrzehnten drastisch gesenkt werden – von 115’000 Tonnen in 1990 auf knapp 90’000 Tonnen heute (blw.ch). Stickstoff wird in Form von Mist, Gülle und Mineraldünger auf Schweizer Feldern ausgebracht. Zu viel ist schlecht für den Boden, die Umwelt und die Biodiversität.
Würde man diese Talflächen für den Anbau von Getreide, Hülsenfrüchten, Gemüse etc. nutzen, könnten mehr Menschen ernährt werden, man müsste weniger Tierfutter importieren, wir hätten keinen Gülleüberschuss und ein minimierter Fleischkonsum wäre erst noch besser für die Umwelt.

Du fandest diesen Artikel interessant? Dann könnten dir diese Artikel auch gefallen:
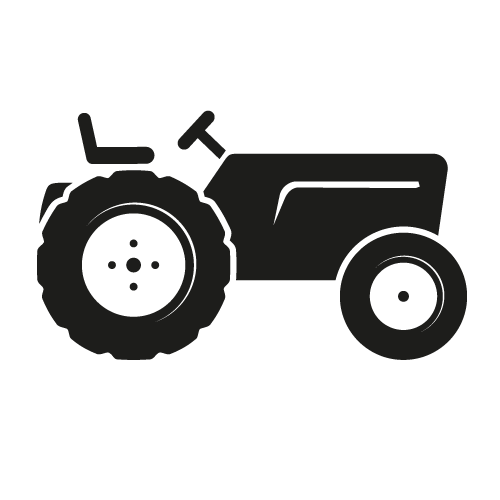









Noch keine Kommentare zu “Wie die Schweiz den Selbstversorgungsgrad erhöhen könnte”