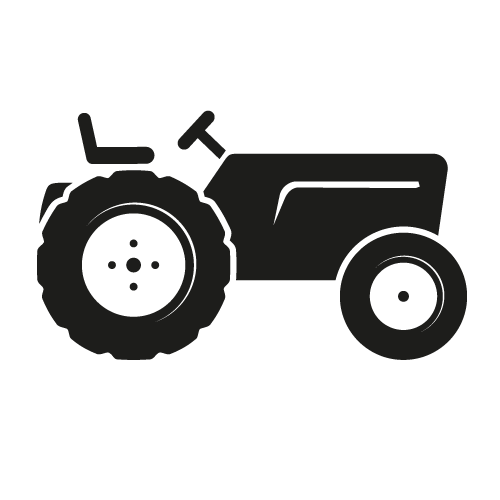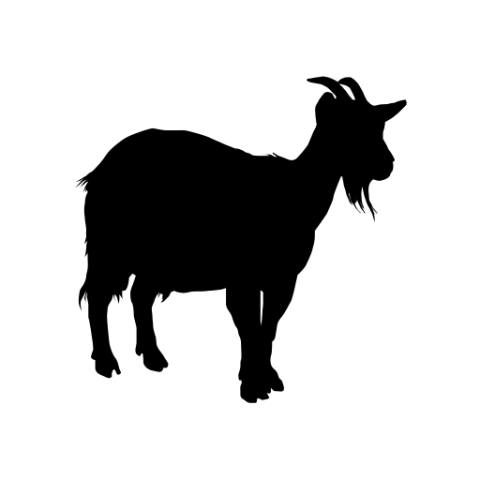Tschau Spargel, hallo Beeren
Die Temperaturen sind schon richtig sommerlich. Mit dem Sommer kommen auch die Beeren und die Zeit zum Selberpflücken zurück. Auf dem Juckerhof in Seegräben könnt ihr in unserer neuen Wildkultur Kirschen und diverse Beeren pflücken. Auf dem Bächlihof geht's bald los mit Heidelbeeren pflücken. Und auf dem Römerhof in Kloten wartet ein Feld voll kunterbuntem Sommerflor.

Selberpflücken – eine alte Idee
Der Selfmade-Trend erlebt schon seit mehrere Jahren einen Aufschwung. Man möchte wieder wissen, wo das…
Weiterlesen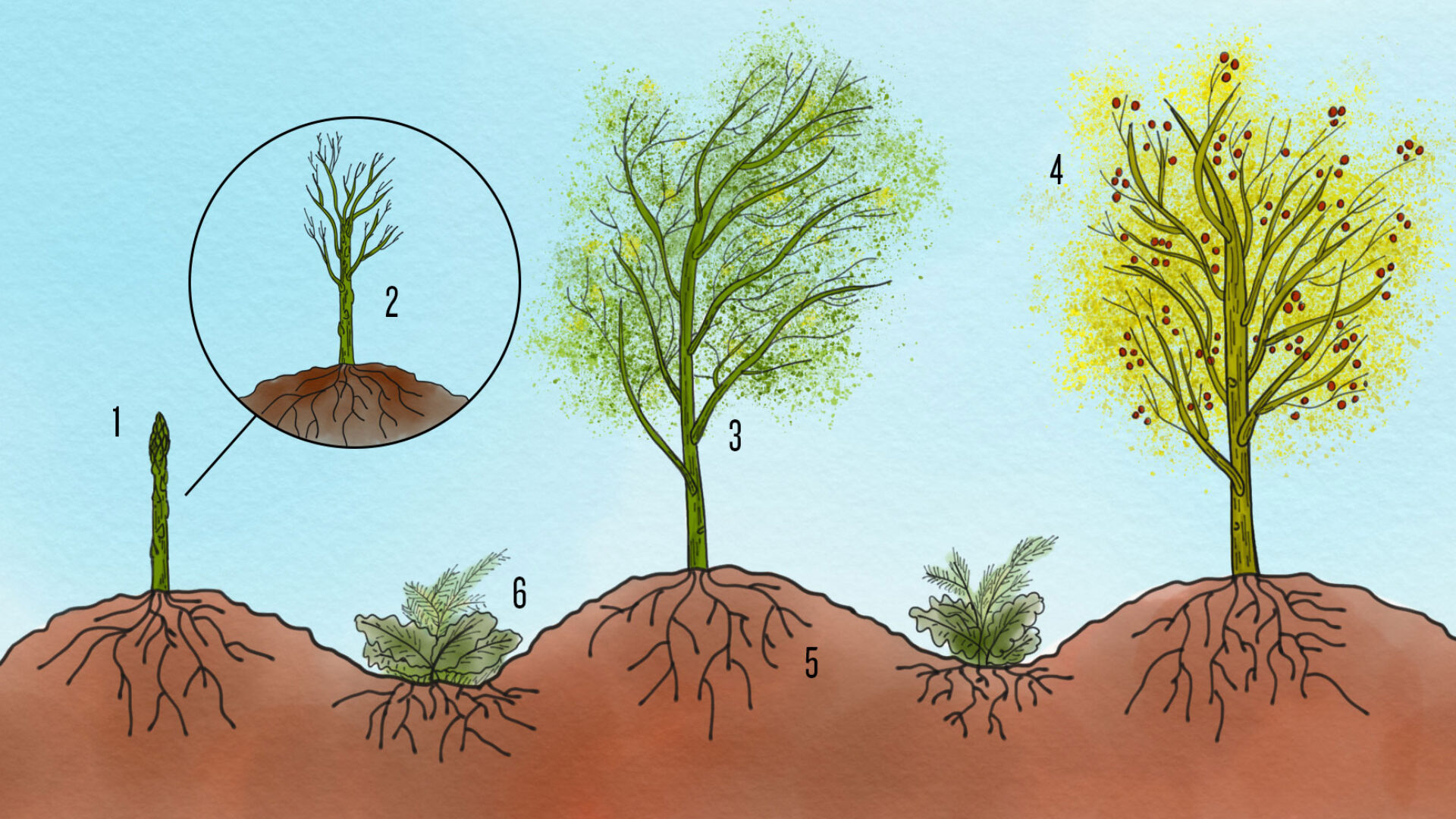
Kirschen rot, Spargel tot
Das Bauern-Sprichwort besagt, dass die Spargelsaison dann endet, wenn die Kirschen reif zum Pflücken sind.
Weiterlesen
Unsere Erdbeeren bekommen eine Stärkungskur
Mitte Mai haben wir die ersten Erdbeeren geerntet und jetzt gibt es die süssen roten…
WeiterlesenTiefer eintauchen
Tiefer eintauchen
Saisonale Rezepte

#FeldFood N°23: Erdbeer-Pavlova

Erdbeer Most
Wie kann man den Jucker Farm Süssmost NOCH besser machen? Mit Saft von unseren Rafzer Freilanderdbeeren!
Jetzt bestellen
Saisonbox Beeren
Unsere Beeren-Box macht schon Lust auf Sommer und ist das ideale Geschenk für alle, die es gerne frisch und süss-sauer mögen.
Box BestellenAlle Themen
Was ist der FarmTicker?
Mit dem FarmTicker erlebst du Landwirtschaft hautnah. Wir liefern: Berichte vom Feld, Antworten auf aktuelle Fragen über den Hof oder die Landwirtschaft, Infos und Rezepte zu saisonalen Produkten und Geschichten vom alltäglichen Leben auf dem Bauernhof. Der FarmTicker bringt das Land der Stadt wieder näher. Betreiberin dieses Online-Magazins ist die Jucker Farm AG. Doch unsere Geschichten und Themen drehen sich nicht nur um uns, sondern um den Bauernhof als Ganzes. Unser Ziel: Sprachrohr für die Landwirtschaft sein.